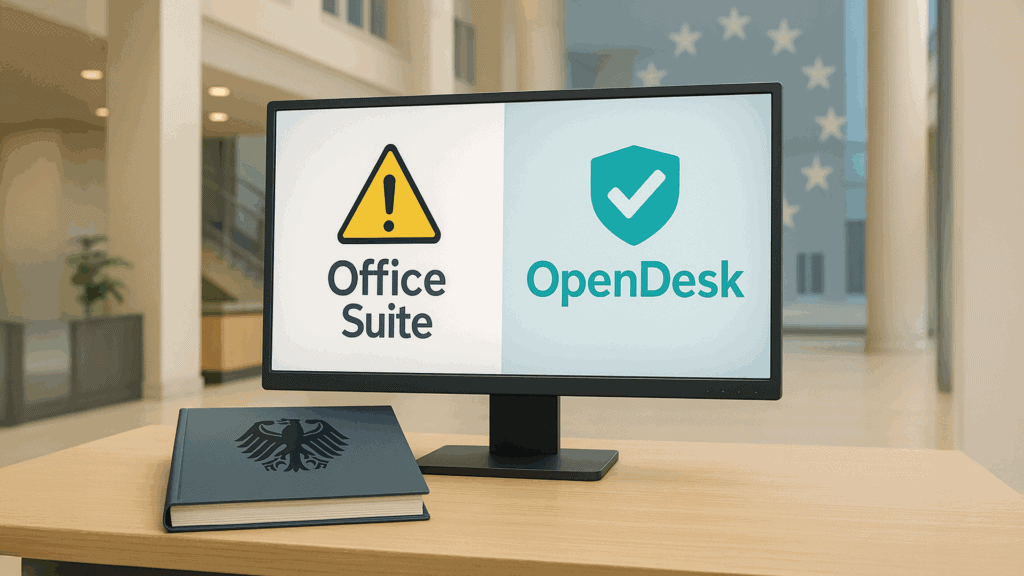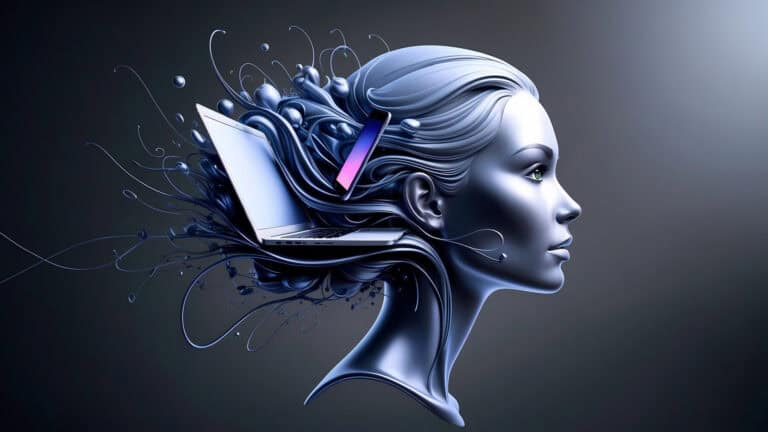Braucht man eine Microsoft 365 Alternative? Microsoft 365 hat sich in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung als Standardlösung für digitale Zusammenarbeit etabliert. Die Plattform bietet eine breite Palette an Anwendungen wie Microsoft Teams, Outlook, Word, Excel, OneDrive und SharePoint – Werkzeuge, die den Austausch von Informationen, das Projektmanagement und die tägliche Kommunikation erheblich erleichtern. Auch hybride Arbeitsmodelle, wie sie zunehmend in der öffentlichen Hand Einzug halten, lassen sich mit Microsoft 365 effizient abbilden.
Ein bedeutender Vorteil ist die Integration aller Dienste in einer einheitlichen Umgebung, die ortsunabhängiges Arbeiten sowie die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden, Ministerien oder Kommunen ermöglicht. In der sogenannten Delos Cloud-Variante, die in Kooperation mit deutschen Partnern entwickelt wurde, erfolgt die Datenverarbeitung in zertifizierten Rechenzentren innerhalb Deutschlands. Diese Infrastruktur wurde auf die Anforderungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) abgestimmt und trägt dem wachsenden Bedürfnis nach IT-Sicherheit Rechnung.
Anhaltende Bedenken trotz lokaler Hosting-Lösungen
Trotz dieser infrastrukturellen Fortschritte bleibt Microsoft 365 ein Produkt eines US-amerikanischen Unternehmens, das unter den Rechtsrahmen der Vereinigten Staaten fällt – insbesondere unter den Cloud Act. Dieser erlaubt es US-Behörden unter bestimmten Bedingungen, auf Daten zuzugreifen, selbst wenn diese außerhalb der USA gespeichert sind. Für die öffentliche Verwaltung in Deutschland, die mit sensiblen personenbezogenen Daten wie Melde- oder Gesundheitsinformationen arbeitet, stellt dies ein erhebliches Risiko dar.
Die zentralen Herausforderungen lassen sich in drei Hauptkategorien gliedern:
Datenschutz und DSGVO-Konformität
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verlangt klare Nachweise darüber, wo und wie personenbezogene Daten verarbeitet werden – inklusive technischer und organisatorischer Maßnahmen zum Schutz dieser Daten. Bei Microsoft 365 gestaltet sich dies trotz deutscher Rechenzentren oftmals intransparent, insbesondere bei der Telemetriedatenerhebung und der Weitergabe an Unterauftragnehmer. Die Datenschutzkonferenzen der Länder (DSK) und die Aufsichtsbehörden äußern regelmäßig Bedenken, ob Microsofts Standardkonfigurationen wirklich den europäischen Anforderungen genügen. Ein rechtskonformer Einsatz ist daher oft nur mit großem konfigurativen Aufwand und ergänzenden Maßnahmen möglich.
Eingeschränkte digitale Souveränität
Digitale Souveränität bedeutet, dass Staaten und öffentliche Einrichtungen in der Lage sein sollten, ihre IT-Infrastrukturen eigenständig und unabhängig zu betreiben und zu kontrollieren. Mit Microsoft 365 bleibt jedoch ein beträchtlicher Teil der Kontrolle bei einem externen Anbieter. Die proprietäre Struktur der Plattform erschwert darüber hinaus die individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen der Verwaltung oder die Integration von Open-Source-Komponenten. Zudem besteht eine starke Abhängigkeit von Lizenzbedingungen und Preisstrategien, die einseitig durch Microsoft verändert werden können.
Kostenstruktur und langfristige Abhängigkeit
Ein weiterer kritischer Aspekt sind die laufenden Lizenzgebühren, die je nach Nutzeranzahl und benötigtem Funktionsumfang erheblich ausfallen können. Diese Kosten steigen in der Regel über die Jahre kontinuierlich an. Zudem sind Behörden oft durch mehrjährige Verträge gebunden, was einen Wechsel zu alternativen Lösungen erschwert. Insbesondere kleine und mittelgroße Kommunen stehen hier vor einer finanziellen Belastung, die nicht immer durch die gebotene Funktionalität gerechtfertigt wird. In vielen Fällen fehlen zudem die personellen und technischen Ressourcen, um die Lösung effektiv zu verwalten oder weiterzuentwickeln.
Weitere Herausforderungen im praktischen Einsatz
Neben den datenschutzrechtlichen und strategischen Bedenken treten in der täglichen Nutzung von Microsoft 365 weitere Probleme auf, die in vielen Behörden spürbar sind:
- Interne Akzeptanzprobleme: Die Einführung und Nutzung von Microsoft 365 erfordert nicht nur eine technische, sondern auch eine kulturelle Transformation. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen neuen cloudbasierten Tools oft skeptisch gegenüber – besonders, wenn die Nutzung durch strenge Datenschutzvorgaben eingeschränkt wird. Das beeinträchtigt die Benutzerfreundlichkeit und kann zu geringer Produktivität führen.
- Technologische Intransparenz: Ein wesentliches Hindernis für viele IT-Verantwortliche ist die eingeschränkte Einsicht in die Funktionsweise von Microsoft 365. Da Quellcode und detaillierte Informationen über Datenverarbeitungsprozesse nicht offenliegen, sind tiefergehende Audits oder individuelle Sicherheitsbewertungen kaum möglich.
- Erschwerte Interoperabilität: Microsofts proprietäre Architektur erschwert die nahtlose Integration mit anderen Systemen oder Open-Source-Lösungen. Das führt häufig zu technischen Hürden bei der Umsetzung von Schnittstellen und begünstigt einen Vendor-Lock-in, der langfristige Flexibilität und Unabhängigkeit einschränkt.
openDesk: Eine Open-Source-Alternative für die öffentliche Verwaltung
openDesk ist eine moderne, modular aufgebaute Open-Source-Lösung, die vom Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS) mit dem Ziel entwickelt wurde, der öffentlichen Verwaltung in Deutschland eine leistungsfähige und datenschutzkonforme Alternative zu proprietären Softwarelösungen wie Microsoft 365 zu bieten. Als staatlich gefördertes Projekt unterliegt openDesk keinem kommerziellen Verwertungsdruck und orientiert sich vollständig an den Bedürfnissen von Behörden, Kommunen und anderen öffentlichen Einrichtungen.
Im Zentrum von openDesk steht die konsequente Bündelung bewährter Open-Source-Komponenten, die in ihrer Kombination eine vollständige Arbeitsumgebung für digitale Zusammenarbeit schaffen:
Nextcloud
Die zentrale Plattform für Dateiablage, Dokumentenaustausch und gemeinsame Bearbeitung. Sie ermöglicht den Zugriff auf Dateien über verschiedene Endgeräte, bietet granulare Rechtevergabe und erfüllt höchste Sicherheitsstandards – einschließlich Audit-Logs, Zwei-Faktor-Authentifizierung und umfassender Verschlüsselungsoptionen.
Collabora Online
Als vollständig webbasierte Office-Suite stellt Collabora ein Äquivalent zu Microsoft Word, Excel und PowerPoint bereit – basierend auf LibreOffice. Dokumente lassen sich in Echtzeit gemeinsam bearbeiten, ohne dass Daten die eigene Infrastruktur verlassen. Funktionen wie Kommentierung, Änderungsverfolgung und Unterstützung gängiger Dateiformate (z. B. .docx, .xlsx, .pptx) ermöglichen eine produktive Arbeitsweise.
Element (Matrix-Protokoll)
Für sichere, dezentrale Kommunikation innerhalb und zwischen Behörden bietet openDesk mit dem Messenger Element eine DSGVO-konforme Alternative zu proprietären Chat-Diensten. Die zugrunde liegende Matrix-Technologie erlaubt verschlüsselte Einzel- und Gruppenchats, Audio-/Videoanrufe sowie Brücken zu anderen Chatdiensten – ein bedeutender Schritt hin zu digitaler Souveränität im Bereich Kommunikation.
OpenProject
Diese Komponente ermöglicht strukturiertes Projektmanagement nach modernen Standards. Ob Gantt-Diagramme, agile Boards, Zeiterfassung oder Aufgabenverteilung – OpenProject unterstützt die Planung und Durchführung von Projekten auf kommunaler und föderaler Ebene mit transparenten Workflows und rollenbasiertem Zugriff.
Einheitliches Nutzererlebnis und technologische Offenheit
Alle Module sind über eine gemeinsame, intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche zugänglich. Dies fördert die Benutzerakzeptanz und reduziert Schulungsaufwand. Gleichzeitig erlaubt das modularisierte System eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen: Behörden können gezielt nur jene Komponenten einsetzen, die sie tatsächlich benötigen, und weitere Open-Source-Werkzeuge (z. B. Etherpad, Jitsi oder OnlyOffice) integrieren.
Ein weiterer zentraler Vorteil liegt in der Offenheit der Architektur: Als quelloffene Plattform erlaubt openDesk tiefgehende individuelle Anpassungen sowie vollständige Kontrolle über Datenflüsse, Sicherheitseinstellungen und Benutzerverwaltung. Die offene API-Struktur ermöglicht darüber hinaus eine einfache Integration in bestehende Verwaltungsprozesse und Fachverfahren.
Technologischer und politischer Rückhalt
Das Projekt openDesk wird durch das Bundesministerium des Innern (BMI) unterstützt und ist Teil der übergeordneten Strategie zur Förderung digitaler Souveränität im öffentlichen Sektor. Es ist als Schlüsselbaustein im Rahmen der Open-Source-Strategie der Bundesregierung positioniert und soll langfristig helfen, die Abhängigkeit von großen internationalen IT-Konzernen zu reduzieren. Erste Pilotprojekte – etwa in kommunalen Verwaltungen oder bei IT-Dienstleistern wie der Kommunalen Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) – zeigen die Praxistauglichkeit und das Entwicklungspotenzial der Lösung.
openDesk stellt somit weit mehr dar als nur ein technisches Werkzeug – es ist Ausdruck eines Paradigmenwechsels in der deutschen Verwaltung: weg von proprietärer Software hin zu offenen, transparenten und gemeinschaftlich entwickelten Systemen, die das Gemeinwohl ins Zentrum stellen.
Datenschutz und DSGVO-Konformität
Der Schutz personenbezogener Daten ist eine zentrale Voraussetzung für den Einsatz digitaler Lösungen in der öffentlichen Verwaltung. Gerade bei sensiblen Informationen – etwa aus dem Meldewesen, dem Sozialbereich oder der innerbehördlichen Kommunikation – gelten besonders hohe Anforderungen an Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) setzt hierfür europaweit verbindliche Standards, deren Umsetzung und Nachweisfähigkeit zunehmend zum Prüfstein für die digitale Transformation im öffentlichen Sektor wird.
openDesk wurde von Grund auf so konzipiert, dass es diesen Anforderungen nicht nur genügt, sondern sie aktiv unterstützt – sowohl technisch als auch organisatorisch. Im Gegensatz zu vielen proprietären Plattformen, deren Datenflüsse schwer nachvollziehbar oder nicht vollständig kontrollierbar sind, ermöglicht openDesk eine DSGVO-konforme Datenverarbeitung durch folgende Schlüsselfunktionen:
Volle Datenhoheit und Betriebsfreiheit
Ein wesentlicher Vorteil von openDesk ist die Wahlfreiheit beim Betrieb: Öffentliche Einrichtungen können die Software vollständig in ihren eigenen Rechenzentren oder über souveräne Cloud-Infrastrukturen betreiben. Dies verhindert eine Auslagerung personenbezogener Daten an Dritte und ermöglicht es, den Zugriff auf Informationen streng zu kontrollieren. So behalten Behörden jederzeit die Kontrolle über Speicherorte, Zugriffsrechte und Sicherheitsrichtlinien – ein bedeutender Schritt hin zu echter digitaler Souveränität.
Maximale Transparenz durch offenen Quellcode
Da openDesk auf Open-Source-Komponenten basiert, ist der gesamte Quellcode öffentlich zugänglich und kann durch unabhängige Dritte geprüft werden. Dies schafft Vertrauen und ermöglicht es IT-Sicherheitsverantwortlichen in Behörden, potenzielle Sicherheitslücken frühzeitig zu erkennen und gezielt zu schließen. Die Transparenz erhöht zudem die Nachvollziehbarkeit der Datenverarbeitung, was bei behördlichen Audits oder Datenschutz-Folgenabschätzungen einen entscheidenden Vorteil darstellt.
Modernste Verschlüsselungstechnologien
openDesk integriert durchgängig Verschlüsselungsmechanismen auf Transport- und Anwendungsebene. Die Kommunikation – etwa über den Messenger „Element“ – erfolgt via Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE), wodurch selbst Dienstbetreiber keine Einsicht in den Nachrichteninhalt erhalten. Auch gespeicherte Daten in der Nextcloud-Komponente können clientseitig verschlüsselt werden. Zusätzlich unterstützt das System Zertifikatsmanagement und sichere Authentifizierungsverfahren wie Single Sign-On (SSO), Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und LDAP-Anbindung.
Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Privacy by Design & Default)
Bereits bei der Implementierung orientiert sich openDesk an den Prinzipien von „Privacy by Design“ und „Privacy by Default“. Das bedeutet, dass datenschutzfreundliche Einstellungen standardmäßig aktiviert sind und Eingriffe in die Privatsphäre minimiert werden. Nutzerdaten werden nur dann verarbeitet, wenn es funktional erforderlich ist – und stets unter Einhaltung der Prinzipien der Datenminimierung und Zweckbindung.
Keine Telemetrie oder versteckte Datenerhebung
Im Gegensatz zu vielen proprietären Cloud-Angeboten erhebt openDesk keine Telemetriedaten im Hintergrund. Das bedeutet, dass keinerlei Nutzungsdaten ohne Wissen und Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer an externe Server übertragen werden – ein Aspekt, der in der Diskussion um DSGVO-Konformität von zentraler Bedeutung ist. Die vollständige Kontrolle über Analyse- und Logging-Funktionen bleibt bei der betreibenden Behörde.
Zusatznutzen im behördlichen Kontext
Neben den grundlegenden Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit bietet openDesk weitere strategische und praktische Vorteile, die besonders für öffentliche Institutionen von hoher Relevanz sind.
Auditierbarkeit: Volle Prüfbarkeit und individuelle Kontrolle
Ein entscheidender Vorteil von Open-Source-Lösungen wie openDesk liegt in der vollständigen Auditierbarkeit der eingesetzten Software. Behörden können den Quellcode und die gesamte Systemarchitektur durch eigene IT-Sicherheitsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte oder externe Prüfer analysieren lassen. Dies ermöglicht eine lückenlose Prüfung auf:
- Sicherheitsschwachstellen oder potenzielle Backdoors
- Datenschutzkonformität der Systemkonfiguration
- Konformität mit den IT-Grundschutz-Katalogen des BSI
- Einhaltung branchenspezifischer Regelwerke wie KRITIS oder OZG
Darüber hinaus können Audit- und Prüfprotokolle systematisch dokumentiert werden, was nicht nur das interne Sicherheitsmanagement verbessert, sondern auch bei externen Überprüfungen – z. B. durch Landesdatenschutzbeauftragte – klare Nachweise schafft.
Risikoreduktion: Vermeidung von Kontrollverlust über Daten
Ein wesentlicher Aspekt der digitalen Souveränität ist die Vermeidung externer Einflussnahmen auf hoheitliche Daten. Bei proprietären Cloud-Lösungen besteht – trotz inländischem Hosting – häufig ein Restrisiko, dass Daten durch rechtliche Rahmenbedingungen wie den US CLOUD Act indirekt in die Hände ausländischer Behörden gelangen könnten.
Mit openDesk hingegen behalten Organisationen die volle Kontrolle über alle Datenverarbeitungsprozesse. Durch den lokalen oder souveränen Betrieb innerhalb nationaler Rechtsräume entfällt:
- das Risiko unautorisierter Drittzugriffe
- die Notwendigkeit komplexer Auftragsverarbeitungsverträge mit internationalen Anbietern
- die Abhängigkeit von globalen Infrastrukturanbietern und deren Supportverfügbarkeit
Das reduziert nicht nur juristische Risiken, sondern erhöht auch die Resilienz gegenüber geopolitischen Spannungen, Lieferkettenunterbrechungen oder Cloud-Ausfällen.
Vertrauensbildung: Transparenz als Fundament für digitale Akzeptanz
Verwaltungssysteme, die nachvollziehbar, offen und datenschutzfreundlich gestaltet sind, schaffen eine wichtige Vertrauensbasis gegenüber der Öffentlichkeit. Gerade in Zeiten wachsender Sensibilität für digitale Überwachung, Datenmissbrauch und mangelnde Transparenz ist es für staatliche Institutionen essenziell, mit gutem Beispiel voranzugehen.
Durch den Einsatz von openDesk senden Behörden ein klares Signal:
- An Bürgerinnen und Bürger: Ihre Daten werden sicher, nachvollziehbar und gesetzeskonform verarbeitet.
- An Mitarbeitende: Die eingesetzte Software ist auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und unterstützt eine verantwortungsvolle digitale Arbeitskultur.
- An die Politik: Die öffentliche Verwaltung nimmt ihre Vorbildfunktion ernst und setzt auf zukunftsorientierte, gemeinwohlorientierte IT-Infrastrukturen.
Darüber hinaus fördert openDesk den gesellschaftlichen Diskurs über die Bedeutung von Open Source, digitaler Selbstbestimmung und einem souveränen digitalen Staat – Werte, die weit über den technischen Einsatz hinaus Wirkung entfalten.
Betriebsmodelle und Flexibilität
Ein zentraler Vorteil von openDesk liegt in seiner hohen Flexibilität hinsichtlich des Betriebs – ein Aspekt, der insbesondere für die heterogene Landschaft der öffentlichen Verwaltung von großer Bedeutung ist. Denn Kommunen, Landesbehörden und Bundesministerien unterscheiden sich teils erheblich in Bezug auf IT-Infrastruktur, personelle Kapazitäten und Sicherheitsanforderungen. openDesk trägt dieser Realität Rechnung, indem es drei differenzierte Betriebsmodelle anbietet, die passgenau auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmt sind:
Self-Hosting: Maximale Kontrolle und Unabhängigkeit
Für Behörden mit eigener IT-Abteilung und ausreichenden Ressourcen empfiehlt sich der Betrieb von openDesk im eigenen Rechenzentrum. Diese Variante bietet:
- Volle Souveränität über die Datenverarbeitung: Sämtliche Daten verbleiben innerhalb der behördlichen Infrastruktur.
- Individuelle Sicherheitsarchitekturen: Die Lösung kann exakt an bestehende IT-Sicherheitskonzepte angepasst und in bestehende Identity-Management- und Backup-Systeme integriert werden.
- Keine Abhängigkeit von Drittanbietern: Updates, Skalierung und Betriebsparameter können vollständig intern gesteuert werden.
Diese Betriebsform eignet sich insbesondere für große Landes- oder Bundesbehörden sowie kommunale IT-Dienstleister mit kritischen Aufgaben wie Katastrophenschutz, Gesundheitswesen oder Steuerverwaltung.
Managed Service: Outsourcing mit Compliance-Garantie
Nicht jede Verwaltung verfügt über die nötige Infrastruktur oder das Fachpersonal, um openDesk selbst zu betreiben. In solchen Fällen bietet sich das Modell „Managed Service“ an. Dabei übernehmen qualifizierte Dienstleister wie KDO, Dachs IT oder andere auf den Public Sector spezialisierte Anbieter den Betrieb – auf Wunsch auch in zertifizierten, datenschutzkonformen Rechenzentren innerhalb Deutschlands.
Vorteile des Managed Service-Modells:
- Entlastung der eigenen IT: Wartung, Patching, Monitoring und Support werden ausgelagert.
- Schnelle Einsatzbereitschaft: Dank standardisierter Setups ist eine zügige Implementierung möglich – ideal für Pilotprojekte oder die Einführung in mehreren Dienststellen gleichzeitig.
- Skalierbarkeit: Kapazitäten lassen sich dynamisch anpassen, z. B. bei wachsenden Nutzerzahlen oder steigenden Speicherbedarfen.
Diese Variante ist besonders attraktiv für mittlere Kommunen, Schulträger oder Fachabteilungen mit spezifischen Anforderungen, aber ohne eigene Rechenzentrumsinfrastruktur.
Community Edition: Einstieg für kleine Organisationen und Testumgebungen
Die Community Edition von openDesk richtet sich an kleinere Verwaltungen, gemeinnützige Organisationen oder Behörden, die die Lösung zunächst in einer Testumgebung oder Pilotphase ausprobieren möchten. Sie umfasst den vollen Funktionsumfang der Plattform, basiert auf den identischen Open-Source-Komponenten und kann kostenfrei heruntergeladen und eingesetzt werden.
Besonderheiten der Community Edition:
- Ideal für Evaluierung und Machbarkeitsstudien
- Aktive Open-Source-Community für Unterstützung, Austausch und Erweiterungen
- Niedrige Einstiegshürde: Keine Lizenzkosten, einfache Installation auf Standard-Servern
Die Community Edition ist eine optimale Lösung für kleinere Teams oder Projektgruppen, die erste Erfahrungen mit der Plattform sammeln wollen – bevor ein institutioneller Roll-out erfolgt.
Strategischer Nutzen durch flexible Betriebsmodelle
Die Vielfalt der angebotenen Betriebsmodelle ermöglicht es öffentlichen Einrichtungen, maßgeschneiderte Einführungsstrategien zu entwickeln – vom kleinen Pilotprojekt bis hin zur vollständigen Systemumstellung. Behörden können:
- mit einer schlanken Cloud-Lösung starten und später in den Eigenbetrieb wechseln,
- ihre Systeme schrittweise migrieren, ohne bestehende Strukturen zu gefährden,
- sicherstellen, dass alle datenschutzrechtlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen eingehalten werden – unabhängig von ihrer internen IT-Leistungsfähigkeit.
Diese Flexibilität fördert Organisationsautonomie, Ressourcenschonung und Planbarkeit – drei entscheidende Faktoren für eine nachhaltige Digitalisierung im öffentlichen Sektor.
Vor- und Nachteile im Vergleich zu Microsoft 365
Die Wahl zwischen einer etablierten Lösung wie Microsoft 365 und einer offenen Alternative wie openDesk hängt stark von den strategischen Prioritäten, rechtlichen Rahmenbedingungen und technischen Kapazitäten einer Behörde ab. Während Microsoft 365 mit einem hohen Funktionsumfang und globaler Verbreitung punktet, bietet openDesk überzeugende Vorteile im Hinblick auf digitale Souveränität, Datenschutz und langfristige Kostenkontrolle.
Vorteile von openDesk
Digitale Souveränität
openDesk ist speziell darauf ausgelegt, der öffentlichen Verwaltung die vollständige Kontrolle über ihre IT-Infrastruktur und Datenverarbeitung zu ermöglichen. Durch den quelloffenen Aufbau, die lokalen Betriebsoptionen und den Verzicht auf proprietäre Abhängigkeiten können Behörden:
- Hoheitliche Daten vollständig im nationalen Rechtsraum verarbeiten,
- Die Kontrolle über Updates, Funktionen und Schnittstellen behalten,
- Unabhängig von Lizenzpolitik und Produktentscheidungen globaler Anbieter bleiben.
Gerade vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und wachsender regulatorischer Anforderungen ist digitale Souveränität ein strategisches Ziel vieler Verwaltungseinheiten auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene.
DSGVO-Konformität
Durch transparente Datenverarbeitung, Verzicht auf Telemetrie, vollständige Auditierbarkeit und die Möglichkeit, sämtliche Komponenten auf eigenen Servern zu betreiben, erfüllt openDesk die Anforderungen der DSGVO auf technischer, organisatorischer und rechtlicher Ebene in besonderem Maße. Dies verringert rechtliche Risiken und erleichtert die Zusammenarbeit mit Datenschutzbeauftragten und Aufsichtsbehörden.
Kosteneffizienz
openDesk verursacht keine laufenden Lizenzkosten – ein erheblicher Vorteil gegenüber Microsoft 365, dessen Abonnement-Modelle insbesondere bei steigenden Nutzerzahlen schnell ins Gewicht fallen. Zwar entstehen bei openDesk Kosten für Betrieb, Wartung und ggf. externen Support, doch langfristig ergibt sich häufig eine wirtschaftlichere Gesamtkostenstruktur („Total Cost of Ownership“), insbesondere bei Einsatz in großen Organisationen oder über mehrere Jahre hinweg.
Anpassungsfähigkeit und Erweiterbarkeit
Der modulare Aufbau von openDesk ermöglicht es, die Plattform exakt an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. Neue Komponenten können hinzugefügt, bestehende erweitert oder entfernt werden. Auch Schnittstellen zu Fachverfahren, E-Government-Plattformen oder kommunalen Systemen lassen sich flexibel implementieren – ein entscheidender Vorteil in heterogenen IT-Landschaften.
Nachteile von openDesk
Einführungsaufwand und Migrationskomplexität
Die Einführung von openDesk erfordert sorgfältige Planung und Umsetzung. Datenmigration, Schnittstellenanpassung, Benutzerverwaltung und Schulungsmaßnahmen verursachen initialen Aufwand. Bestehende Microsoft-365-Workflows und -Dokumente müssen überprüft und ggf. angepasst werden, um funktional gleichwertige Prozesse abzubilden. Dieser Mehraufwand ist insbesondere in der Anfangsphase spürbar und sollte realistisch einkalkuliert werden.
Funktionalitätsumfang und Integrationstiefe
Microsoft 365 bietet eine Vielzahl spezialisierter Funktionen und eine tiefe Integration über das gesamte Microsoft-Ökosystem hinweg – z. B. Power Automate, Dynamics 365, Teams-Telefonie oder KI-gestützte Tools wie Copilot. Einige dieser Funktionen sind in openDesk (noch) nicht in vollem Umfang abbildbar oder erfordern den Einsatz zusätzlicher Drittkomponenten. Für sehr komplexe oder spezialisierte Anwendungsfälle kann dies Einschränkungen bedeuten.
Support- und Weiterentwicklungsverfügbarkeit
Im Gegensatz zu Microsoft, das globale Supportstrukturen bietet, ist openDesk auf eine Mischung aus Community-Unterstützung und spezialisierten Dienstleistern angewiesen. Zwar entstehen zunehmend professionelle Angebote, doch der Supportstandard variiert je nach Anbieter. Zudem kann die Weiterentwicklung je nach Community-Beteiligung unterschiedlich schnell voranschreiten. Für Behörden mit hohen Anforderungen an Reaktionszeiten oder garantierte Betriebsverfügbarkeit (SLA) ist dies ein wichtiges Abwägungskriterium.
Best Practices für die Implementierung von openDesk
Die Einführung von openDesk in der öffentlichen Verwaltung sollte strategisch geplant, iterativ umgesetzt und organisatorisch begleitet werden. Da es sich bei openDesk um eine modulare Open-Source-Plattform handelt, bietet sie enorme Gestaltungsspielräume – aber auch erhöhte Anforderungen an Koordination, Kommunikation und Technikintegration. Erfolgreiche Einführungsprojekte zeigen, dass die folgenden Best Practices besonders hilfreich sind:
Pilotprojekte und schrittweises Roll-out
Statt openDesk direkt flächendeckend einzuführen, empfiehlt sich ein stufenweiser Ansatz über Pilotprojekte. Dabei testen ausgewählte Dienststellen oder Fachabteilungen die Plattform im Alltag und geben Rückmeldungen zu Funktionalität, Usability und Integrationstauglichkeit. Die Ergebnisse fließen in die Optimierung ein und schaffen Erfahrungswerte für den späteren Vollbetrieb.
Vorteile:
- Reduziertes Projektrisiko
- Frühzeitiges Erkennen technischer oder organisatorischer Hürden
- Erhöhung der Akzeptanz durch „Botschafter“ aus den Pilotbereichen
Schulungen und Change Management
Die technische Bereitstellung allein reicht nicht aus – entscheidend für den Erfolg ist, dass Mitarbeitende kompetent mit openDesk umgehen können. Praxisorientierte Schulungen und digitale Lernformate (z. B. Screencasts, interaktive Handbücher, eLearning-Plattformen) sind essenziell, um die Akzeptanz zu fördern und die Effizienz im Umgang mit neuen Tools zu steigern.
Empfohlene Maßnahmen:
- Schulungskonzepte nach Nutzergruppen (z. B. Endanwender:innen, Administrator:innen)
- „Train-the-Trainer“-Programme für Multiplikator:innen
- Begleitende Kommunikation zur Einordnung der Veränderungen (z. B. durch Intranet-Beiträge oder Infoveranstaltungen)
Zudem sollten Schulungsinhalte regelmäßig aktualisiert werden – insbesondere nach Updates oder bei der Einführung neuer Module.
Systemintegration und Interoperabilität sicherstellen
Ein reibungsloser Übergang zu openDesk gelingt nur, wenn die Plattform nahtlos in die vorhandene IT-Infrastruktur integriert wird. Dazu gehört die Anbindung an zentrale Verzeichnisdienste (LDAP/Active Directory), Fachverfahren, Dokumentenmanagementsysteme (DMS) oder E-Mail-Systeme. Auch Schnittstellen zu Portalen wie OZG-Diensten oder Fachanwendungen sollten frühzeitig geplant werden.
Technische Fokusbereiche:
- SSO-Integration für einheitliche Login-Prozesse
- Dateisynchronisation mit lokalen Netzlaufwerken
- API-Anbindungen an E-Akte, Haushalts-, Personal- oder Fachverfahren
Dabei gilt: Die Modularität von openDesk erlaubt eine etappenweise Integration – Behörden können Schritt für Schritt einzelne Module einführen und testen.
Aufbau tragfähiger Support- und Betriebsstrukturen
Um den Dauerbetrieb sicherzustellen, benötigen Behörden verlässliche Wartungs- und Supportstrukturen. Je nach Betriebsmodell kann dies intern erfolgen (z. B. durch die eigene IT-Abteilung) oder extern (z. B. durch zertifizierte Partner wie Dachs IT oder KDO). Wichtig sind klar definierte Prozesse für:
- 1st- bis 3rd-Level-Support
- Incident-Management und Fehlerverfolgung
- Sicherheits- und Patch-Management
- Monitoring, Backup und Wiederherstellung
Der Abschluss von Service-Level-Agreements (SLAs) stellt sicher, dass Reaktionszeiten, Verfügbarkeit und Sicherheitsstandards verbindlich geregelt sind – besonders wichtig für kritische Verwaltungsprozesse.
Governance, Dokumentation und Qualitätssicherung
Ein oft unterschätzter Erfolgsfaktor ist die Einführung eines klaren Governance-Modells. Zuständigkeiten, Berechtigungskonzepte, Updatezyklen und Dokumentationspflichten sollten eindeutig geregelt sein. Empfehlungen:
- Einrichtung eines Projektbeirats mit Fach- und IT-Vertretungen
- Erstellung eines Betriebskonzepts mit technischen und organisatorischen Richtlinien
- Nutzung von Qualitätssicherungstools zur Überwachung der Systemverfügbarkeit und Performance
Langfristig empfiehlt sich auch der Aufbau eines internen Kompetenzzentrums oder die Beteiligung an übergreifenden Verwaltungsinitiativen (z. B. Open-Source-Netzwerke, Arbeitsgruppen des Bundes).
Fazit: openDesk als zukunftsfähige Alternative für die öffentliche Verwaltung
openDesk stellt eine hochrelevante und nachhaltige Antwort auf die drängenden Herausforderungen der Digitalisierung im öffentlichen Sektor dar. Als Open-Source-basierte, DSGVO-konforme Kollaborationsplattform vereint es technologische Leistungsfähigkeit mit rechtlicher Sicherheit und strategischer Unabhängigkeit. In einer Zeit, in der Vertrauen in digitale Infrastrukturen und Kontrolle über Datenverarbeitung zentrale Themen der Verwaltungsmodernisierung sind, bietet openDesk ein überzeugendes Gesamtpaket.
Die Plattform ist modular, transparent und anpassbar – Eigenschaften, die gerade in einer föderal strukturierten Verwaltung mit sehr unterschiedlichen Anforderungen von großer Bedeutung sind. Kommunale IT-Dienstleister können gezielt einzelne Komponenten wie Nextcloud oder OpenProject in bestehende Umgebungen integrieren, während Bundesbehörden vollständige Systemarchitekturen implementieren können, ohne auf zentrale Vorgaben angewiesen zu sein.
Strategischer Mehrwert für den öffentlichen Dienst
Neben operativen Vorteilen liefert openDesk einen klaren Beitrag zur digitalen Souveränität der Bundesrepublik. Der Verzicht auf proprietäre Abhängigkeiten von globalen Tech-Konzernen und die Möglichkeit, sämtliche Daten innerhalb Deutschlands zu speichern und zu verarbeiten, reduzieren nicht nur rechtliche und sicherheitstechnische Risiken, sondern stärken auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die digitale Verwaltung.
Zudem signalisiert der Einsatz von openDesk eine politische Haltung: für Transparenz, Gemeinwohlorientierung und Innovationsfähigkeit. Die Plattform wird nicht nur technisch, sondern auch institutionell getragen – durch das Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS), das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) und eine wachsende Community aus Anwendern und Entwicklern.
Wirtschaftliche und organisatorische Nachhaltigkeit
Auch unter dem Aspekt der Kostenkontrolle und Investitionssicherheit ist openDesk attraktiv. Es entfallen nicht nur Lizenzgebühren, sondern auch langfristige Abhängigkeiten von kommerziellen Vertragsmodellen. Behörden erhalten stattdessen die Möglichkeit, Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung flexibel an eigene Mittel und strategische Prioritäten anzupassen – sei es im Eigenbetrieb, durch Partner oder in hybriden Modellen.
In Kombination mit bewährten Best Practices zur Einführung, Schulung und Governance lässt sich openDesk schrittweise und risikoarm implementieren – vom kleinen Pilotprojekt bis zur umfassenden Plattformlösung. Die vorhandenen Betriebsmodelle – Self-Hosting, Managed Service oder Community Edition – bieten für jede Ausgangslage eine passende Option.
Zukunftssicherheit und offene Perspektiven
openDesk ist nicht nur eine Alternative – es ist ein digitales Ökosystem mit offenem Entwicklungspfad. Durch den offenen Quellcode, kontinuierliche Community-Beiträge und die Unterstützung durch öffentliche Förderprogramme entsteht eine Lösung, die dynamisch weiterentwickelt und an neue Anforderungen angepasst werden kann – sei es in Bezug auf KI-Integration, Barrierefreiheit, Fachverfahrensanbindung oder mobile Nutzung.
Diese Offenheit macht openDesk nicht nur zukunftsfähig, sondern auch anschlussfähig: an bestehende Digitalisierungsstrategien wie das Onlinezugangsgesetz (OZG), die Open-Source-Strategie des Bundes oder länderübergreifende Kooperationsprojekte.