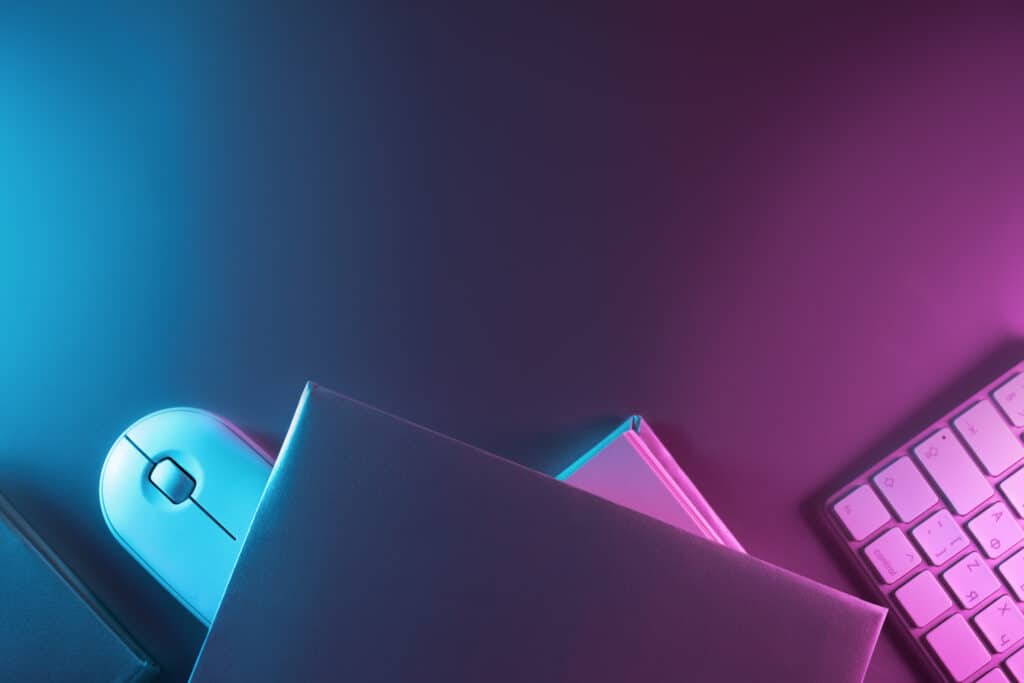Im Oktober 2025 endet offiziell der Support für zwei zentrale Microsoft-Produkte, die in vielen Unternehmen nach wie vor zum Einsatz kommen: Windows 10 und Office 2019. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Update-Szenario erscheinen mag, hat tiefgreifende Konsequenzen – insbesondere für die IT-Sicherheit, Systemkompatibilität und die langfristige Planbarkeit von IT-Infrastrukturen.
Der Stichtag, der seitens Microsoft bereits klar kommuniziert wurde, bedeutet für viele Unternehmen ein kritisches Datum. Ab dem 14. Oktober 2025 stellt Microsoft keine Sicherheitsupdates, Fehlerbehebungen oder technischen Support mehr für diese beiden Produkte bereit. In der Praxis heißt das: Wer weiterhin auf Windows 10 oder Office 2019 setzt, geht ein hohes Risiko ein – sowohl in puncto Datenschutz als auch bei der Systemstabilität und Integrationsfähigkeit mit modernen Anwendungen.
Für IT-Abteilungen bedeutet das Support-Ende also nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch einen organisatorischen und strategischen Umbruch. Die betroffenen Systeme müssen evaluiert, Entscheidungen über Upgrades oder Migrationen getroffen und neue Sicherheitskonzepte aufgesetzt werden.
Auch vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen und einer zunehmenden Bedrohungslage durch Cyberkriminalität ist Handlungsbedarf gegeben. Besonders Unternehmen mit sensiblen Daten – etwa aus dem Gesundheitswesen, dem Finanzsektor oder der öffentlichen Verwaltung – können es sich nicht leisten, auf nicht unterstützter Software zu arbeiten.
In diesem Beitrag beleuchten wir deshalb:
- Was das Support-Ende konkret bedeutet
- Welche Risiken sich daraus ergeben
- Welche Handlungsoptionen Unternehmen haben
- Und wie Sie mit einem klaren Fahrplan sicher und strategisch in die Zukunft gehen
GECKO unterstützt Unternehmen dabei mit individuellen IT-Strategien, umfassender Migrationsberatung und Managed Services. Doch zunächst werfen wir einen genauen Blick auf die Fakten zum Support-Ende von Windows 10 und Office 2019.
Was bedeutet es, dass der Support für Windows 10 und Office 2019 endet?
Microsoft definiert den Lebenszyklus seiner Produkte klar: Mit dem Ablauf des sogenannten „Extended Support“ erhalten Nutzer keine Sicherheitsupdates, keine Fehlerbehebungen und keinen technischen Support mehr. Für Windows 10 endet dieser Zeitraum am 14. Oktober 2025 – ebenso wie für Office 2019 und Office 2016.
Windows 10: Das Ende einer Ära
Windows 10, das 2015 eingeführt wurde, hat sich in den letzten Jahren zur dominanten Windows-Version entwickelt. Mit der letzten offiziellen Version 22H2 wird das System nun in den Ruhestand geschickt. Nach dem Support-Ende bedeutet das:
- Keine Sicherheitsupdates mehr: Neue Schwachstellen bleiben offen – ein erhebliches Risiko für Unternehmensnetzwerke.
- Kein technischer Support von Microsoft: Auch bei Problemen oder Inkompatibilitäten steht keine Hilfe mehr zur Verfügung.
- Keine Kompatibilität mit neuen Anwendungen: Zunehmend werden moderne Softwarelösungen nur noch für Windows 11 optimiert.
Eine gewisse Ausnahme bildet das kostenpflichtige Programm für erweiterte Sicherheitsupdates (ESU):
- Für Privatnutzer: Ein Jahr kostenlose Updates (bis 13.10.2026) bei Anmeldung mit Microsoft-Konto oder Nutzung von Microsoft Rewards.
- Für Unternehmen: Drei Jahre verlängerte Sicherheitsupdates bis 2028, jedoch kostenpflichtig und gestaffelt im Preis.
Office 2019: End-of-Life auch für die Office-Suite
Auch die Office-Versionen 2016 und 2019 erreichen am 14. Oktober 2025 ihr Lebensende. Das betrifft sowohl Home- als auch Pro-Versionen sowie sämtliche Volumenlizenz-Editionen. Die Konsequenzen sind ähnlich drastisch:
- Keine weiteren Sicherheitsupdates: Erhöhte Gefahr durch Phishing, Malware und andere Angriffsformen.
- Keine Funktions- oder Kompatibilitätsupdates: Besonders in Cloud- und Kollaborationsumgebungen kann das zu Problemen führen.
- Keine technische Unterstützung: Probleme müssen intern gelöst werden – mit entsprechendem Aufwand.
Darüber hinaus stellt Microsoft schrittweise die Kompatibilität von Microsoft 365-Diensten mit älteren Office-Versionen ein. Besonders Cloud-Dienste wie SharePoint, Teams oder Outlook 365 setzen zunehmend auf aktuelle Clientsoftware – Unternehmen mit Office 2019 könnten dadurch in Funktionalität und Zusammenarbeit eingeschränkt werden.
Überblick: Support-Ende im Zeitstrahl
| Produkt | Support-Ende | Updates möglich? | Sonderregelung |
|---|---|---|---|
| Windows 10 | 14.10.2025 | Nein | ESU bis 2028 (kostenpflichtig) |
| Office 2019 | 14.10.2025 | Nein | Keine – Umstieg erforderlich |
| Office 2016 | 14.10.2025 | Nein | Keine – Umstieg erforderlich |
Der Ablauf dieses Supports ist nicht nur ein formales Datum – er hat tiefgreifende Auswirkungen auf die IT-Sicherheit, Betriebsfähigkeit und Zukunftsplanung von Unternehmen. Im nächsten Abschnitt zeigen wir auf, welche Risiken sich aus der Weiternutzung ergeben und warum jetzt strategisches Handeln gefragt ist.
Welche Risiken entstehen für Unternehmen?
Das Ende des offiziellen Supports für Windows 10 und Office 2019 markiert nicht nur ein technisches Ablaufdatum – es stellt auch ein erhebliches Sicherheits- und Compliance-Risiko dar. Unternehmen, die nach dem 14. Oktober 2025 weiterhin auf diese Systeme setzen, agieren in einem zunehmend unsicheren und regulatorisch problematischen Umfeld.
1. Sicherheitslücken ohne Updates
Der größte Risikofaktor liegt in der fehlenden Versorgung mit Sicherheitsupdates. Neue Schwachstellen in Windows 10 oder Office 2019, die nach dem Support-Ende entdeckt werden, bleiben ungepatcht. Das macht Systeme anfällig für:
- Ransomware-Angriffe
- Datendiebstahl und Spionage
- Manipulation oder Zerstörung von Daten
Angreifer konzentrieren sich gezielt auf veraltete Systeme, da sie wissen, dass diese nicht mehr abgesichert sind. Für Unternehmen mit sensiblen oder personenbezogenen Daten – etwa im Gesundheitswesen, der Finanzbranche oder im öffentlichen Dienst – ist das besonders kritisch.
2. Verstöße gegen Datenschutzverordnungen
In der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die Absicherung personenbezogener Daten verpflichtend. Der Einsatz veralteter, nicht mehr unterstützter Software kann als grobe Fahrlässigkeit gewertet werden. Das kann:
- Bußgelder in sechs- bis siebenstelliger Höhe
- Imageverluste bei Kunden und Partnern
- Haftungsrisiken für Geschäftsführung oder IT-Leitung
nach sich ziehen.
3. Kompatibilitätsprobleme und Produktivitätsverluste
Ohne Updates verlieren Systeme schrittweise die Kompatibilität mit moderner Software und Diensten. Besonders betroffen sind Anwendungen mit Cloud-Integration, wie Microsoft Teams, Exchange Online oder SharePoint. Auswirkungen können sein:
- Probleme bei der Nutzung von Microsoft 365
- Fehlende Schnittstellen zu modernen Tools (z. B. CRM-, ERP-Systeme)
- Einschränkungen bei neuen Druckertreibern oder Hardware
Langfristig entstehen so Produktivitätsverluste, die sich auf die gesamte Organisation auswirken können.
4. Erschwerte IT-Betreuung
Auch Dienstleister und Hersteller stellen mit dem offiziellen Support-Ende ihre Kompatibilität ein. IT-Abteilungen sehen sich dann gezwungen, bei Problemen Notlösungen zu improvisieren oder vollständig auf Eigenverantwortung umzusteigen. Das erhöht den Betreuungsaufwand und die Betriebskosten deutlich.
Upgrade auf Windows 11 – sinnvoll oder nötig?
Angesichts des bevorstehenden Support-Endes von Windows 10 stellt sich für viele Unternehmen die zentrale Frage: Ist ein Umstieg auf Windows 11 zwingend erforderlich – oder gibt es sinnvolle Alternativen?
Die Antwort hängt stark von der individuellen IT-Landschaft, den vorhandenen Systemressourcen und den sicherheitsrelevanten Anforderungen ab. Grundsätzlich gilt jedoch: Ein Upgrade auf Windows 11 ist langfristig der empfohlene Weg, insbesondere wenn folgende Bedingungen erfüllt sind.
1. Technische Kompatibilität prüfen
Nicht alle Geräte, auf denen Windows 10 läuft, erfüllen die Anforderungen für Windows 11. Microsoft setzt unter anderem folgende technische Standards voraus:
- TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
- UEFI mit Secure Boot
- Unterstützte CPU-Generationen (Intel 8. Gen oder neuer, AMD Ryzen 2000 oder neuer)
- Mindestens 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz
Ein kostenloses Tool wie der PC Health Check oder Drittanbieter wie WhyNotWin11 helfen bei der Überprüfung der Kompatibilität.
Studien zufolge ist etwa die Hälfte aller Windows-10-PCs in Unternehmen nicht upgradefähig auf Windows 11 – das bedeutet: Es besteht entweder Nachrüstbedarf oder Investitionsbedarf in neue Hardware.
2. Windows 11: Vorteile für Unternehmen
Windows 11 bietet nicht nur ein modernes Design, sondern auch handfeste Verbesserungen für den Unternehmensalltag:
- Stärkere Sicherheitsfunktionen (z. B. Virtualization-Based Security, Hardware-basierte Isolierung)
- Optimierung für Cloud und hybride Arbeitsmodelle
- Verbesserte Performance durch effizienteres Ressourcenmanagement
- Zukunftssicherheit: Alle neuen Funktionen von Microsoft 365 sind auf Windows 11 optimiert
Zudem unterstützt Microsoft Windows 11 bis mindestens Oktober 2031 – Unternehmen erhalten damit wieder ein langfristiges, wartbares Betriebssystem.
3. Was tun bei inkompatibler Hardware?
Nicht jeder Rechner lässt sich ohne Weiteres auf Windows 11 aufrüsten. Hier ergeben sich drei Alternativen:
- Hardware-Austausch: Investition in neue, Windows-11-kompatible Geräte – oft wirtschaftlich sinnvoll, wenn ohnehin Modernisierung geplant ist.
- Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel): Spezielle Windows-Version mit verlängertem Support bis 2032 – allerdings mit eingeschränkten Funktionen und nur für spezielle Anwendungsfälle.
- ESU-Programm: Erweiterte Sicherheitsupdates gegen Gebühr – eher als Übergangslösung geeignet, nicht für dauerhaften Einsatz empfohlen.
4. Office-Upgrade nicht vergessen
Ein Upgrade auf Windows 11 sollte auch mit einem Wechsel von Office 2019 auf eine aktuelle Version (z. B. Microsoft 365 oder Office 2021/2024) verbunden werden. Nur so lassen sich:
- Sicherheitsstandards einhalten
- volle Kompatibilität mit Microsoft-365-Diensten gewährleisten
- neue Funktionen und Integrationen nutzen
Alternativen zu Windows 10 und Office 2019
Nicht alle Unternehmen können oder wollen sofort auf Windows 11 und Microsoft 365 umsteigen. Gründe dafür können technische Restriktionen, Budgetgrenzen oder spezielle Softwareanforderungen sein. Glücklicherweise gibt es verschiedene Alternativen, die – zumindest temporär – eine Brücke schlagen oder sogar langfristige Lösungen darstellen können.
1. Windows 10 LTSC – die Langzeitlösung für Spezialfälle
Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel) richtet sich vor allem an spezialisierte Geräte und Umgebungen, z. B. in der Produktion, Medizintechnik oder im Kiosk-Betrieb. Der große Vorteil: Der Supportzeitraum reicht bis 2032, Sicherheitsupdates sind somit langfristig gesichert.
Vorteile:
- Verlängerter Support (bis zu 10 Jahre)
- Keine Feature-Updates, nur sicherheitsrelevante Patches
- Keine Microsoft Store- oder Consumer-Apps vorinstalliert
Nachteile:
- Keine Unterstützung für Microsoft 365
- Einschränkungen bei modernen Funktionen (z. B. Cloud-Integration)
- Volumenlizenzierung notwendig – nicht für Einzelnutzer verfügbar
Fazit: Ideal für Unternehmen mit stabilen, wenig veränderlichen Systemanforderungen – nicht aber als Arbeitsplatzlösung für moderne Office-Umgebungen.
2. Erweiterte Sicherheitsupdates (ESU) kaufen
Für Unternehmen, die Windows 10 weiterhin einsetzen müssen, bietet Microsoft kostenpflichtige ESU-Lizenzen an. Diese erlauben den Bezug von Sicherheitsupdates bis Oktober 2028.
Staffelpreise (pro Gerät):
- Jahr 1: ca. 61 USD
- Jahr 2: ca. 122 USD
- Jahr 3: ca. 244 USD
Einschränkungen:
- Nur Sicherheitsupdates – keine neuen Funktionen oder Kompatibilitätsanpassungen
- Technischer Support von Microsoft nur eingeschränkt
- Langfristig kostenintensiver als ein reguläres Upgrade
Fazit: ESU ist eine Übergangslösung, sinnvoll bei begrenzten Zeit- oder Budgetressourcen – aber keine Daueroption.
3. Wechsel zu Linux oder ChromeOS Flex
Für bestimmte Anwendungsbereiche kann sich ein Wechsel auf ein alternatives Betriebssystem lohnen:
- Linux-Distributionen wie Ubuntu, Debian oder Linux Mint bieten moderne Desktops, hohe Sicherheit und freie Software
- ChromeOS Flex von Google ist besonders für ältere Geräte geeignet – cloudzentriert und ressourcenschonend
Vorteile:
- Keine Lizenzkosten
- Regelmäßige Updates und hohe Stabilität
- Gute Integration für Webanwendungen
Nachteile:
- Eingeschränkte Softwarekompatibilität (v. a. bei Spezialanwendungen)
- Migrationsaufwand und Schulungsbedarf
- Begrenzte Integration mit Microsoft-Ökosystem
Fazit: Für webbasierte Arbeitsplätze oder Bildungseinrichtungen durchaus attraktiv – für komplexe Unternehmensumgebungen nur eingeschränkt geeignet.
4. Office-Alternativen: LibreOffice, OnlyOffice & Co.
Wenn ein Umstieg auf Microsoft 365 nicht möglich oder gewünscht ist, können Open-Source-Alternativen in Betracht gezogen werden:
- LibreOffice: Umfangreiche Funktionen, hohe Kompatibilität zu älteren Office-Dateien
- OnlyOffice: Moderne Oberfläche, gute Zusammenarbeit in Teams
- SoftMaker Office: Kommerzielle Alternative aus Deutschland, hohe Microsoft-Kompatibilität
Nachteile:
- Begrenzte Kompatibilität bei komplexen Excel- oder PowerPoint-Funktionen
- Kein vollständiger Ersatz für Microsoft 365-Funktionen (z. B. Outlook-Integration, Cloud-Tools)
- Eingeschränkter Support und keine zentrale Administration
Fazit: Für einfache Office-Aufgaben gut geeignet – bei komplexeren Szenarien oder großen Benutzerzahlen jedoch mit Nachteilen verbunden.
Best Practices für Unternehmen – Handlungsempfehlungen
Ein erfolgreiches Reaktionsmodell auf das Support-Ende von Windows 10 und Office 2019 beginnt nicht mit der Migration, sondern mit einer systematischen Vorbereitung. Unternehmen, die jetzt strategisch und strukturiert vorgehen, vermeiden nicht nur Sicherheitsrisiken, sondern profitieren langfristig von stabilen, leistungsfähigen und zukunftssicheren IT-Strukturen.
Im Folgenden finden Sie bewährte Best Practices für Unternehmen, die den Umstieg meistern wollen:
1. Bestandsaufnahme und Systemanalyse
Der erste Schritt ist die vollständige Erfassung aller betroffenen Systeme:
- Welche Geräte laufen noch unter Windows 10?
- Welche Office-Versionen sind im Einsatz?
- Welche Systeme sind geschäftskritisch und welche können später migriert werden?
Tipp: Nutzen Sie automatisierte Inventarisierungstools (z. B. Lansweeper, baramundi oder Intune), um die Systemlandschaft effizient zu erfassen.
2. Kompatibilitätsprüfung durchführen
Nicht jedes Gerät ist automatisch upgradefähig auf Windows 11. Eine Prüfung der Systemvoraussetzungen schafft Klarheit:
- TPM 2.0 aktiviert?
- UEFI und Secure Boot vorhanden?
- Prozessor auf Kompatibilitätsliste?
Empfehlung: Verwenden Sie Microsofts PC Health Check oder WhyNotWin11 für schnelle Ergebnisse.
3. Risikobewertung und Priorisierung
Nicht jede Migration muss sofort erfolgen – entscheidend ist, die größten Risiken zuerst zu adressieren:
- Systeme mit Zugang zu sensiblen Daten
- Netzwerkknoten und Schnittstellenserver
- Clients mit direktem Internetzugang
Stellen Sie für jede Kategorie einen eigenen Migrationsplan auf – abgestuft nach Risiko und Dringlichkeit.
4. Strategieentscheidung: Upgrade oder Ersatz?
Basierend auf der Analyse können IT-Verantwortliche entscheiden:
- Upgrade auf Windows 11/Microsoft 365 bei kompatibler Hardware
- Hardwaretausch bei nicht erfüllten Systemvoraussetzungen
- Temporäre Verlängerung mit ESU bei Investitionsbedarf
- Wechsel zu LTSC, Linux oder ChromeOS Flex bei Sonderanwendungen
Ein strukturierter Entscheidungsbaum erleichtert die richtige Zuordnung.
5. Pilotphase einplanen
Führen Sie den Umstieg in einer kontrollierten Pilotphase durch – typischerweise mit 5–10 % der Benutzergruppe:
- Test der Applikationskompatibilität
- Usability-Bewertung durch Key-User
- Feedback sammeln und Prozesse optimieren
Dadurch vermeiden Sie später großflächige Rollout-Probleme und sichern die Akzeptanz der Nutzer.
6. Schulungen und Change Management
Ein neues Betriebssystem oder eine neue Office-Version erfordert Umdenken bei den Mitarbeitern. Frühzeitige Maßnahmen sorgen für reibungslosere Übergänge:
- E-Learning-Kurse und Videotutorials
- Webinare oder Präsenztrainings
- Begleitende Kommunikation (z. B. FAQ, Infografiken, Anleitungen)
Ein starkes Change-Management ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Migration.
7. Datenschutz und IT-Sicherheit einbeziehen
Bei der Umstellung dürfen Security- und Datenschutzmaßnahmen nicht vernachlässigt werden:
- Überprüfung von Antivirus- und Endpoint-Protection-Lösungen
- Anpassung der Backup- und Wiederherstellungskonzepte
- Dokumentation der Maßnahmen im Rahmen der DSGVO
Besonders bei hybriden Infrastrukturen oder Cloud-Lösungen müssen neue Richtlinien definiert werden.
8. Zeitplan und Budget festlegen
Abschließend sollte ein verbindlicher Zeit- und Budgetplan aufgestellt werden:
- Zeitfenster für Umstellungen definieren (Wochenenden, Ferienzeiten etc.)
- Interne und externe Ressourcen abstimmen
- Lizenzkosten, Hardware und Dienstleisterangebote einplanen
Ein realistischer Fahrplan verhindert ungeplante Engpässe und sorgt für transparente Kostenkontrolle.
GECKO als Ihr Partner für IT-Migration und Sicherheit
Ein reibungsloser und sicherer Umstieg auf neue Systeme wie Windows 11 und Microsoft 365 erfordert mehr als nur Software-Upgrades: Es braucht ein tiefes Verständnis für Prozesse, IT-Infrastrukturen, Compliance-Anforderungen und Benutzerbedürfnisse. Genau hier kommt GECKO ins Spiel.
1. Individuelle Analyse Ihrer IT-Landschaft
GECKO beginnt jeden Migrationsprozess mit einer umfassenden Systemanalyse:
- Ermittlung aller betroffenen Geräte und Office-Installationen
- Prüfung auf Windows-11-Kompatibilität
- Analyse der Business-Applikationen und Abhängigkeiten
Dadurch erhalten Sie eine vollständige Entscheidungsgrundlage – übersichtlich, priorisiert und nachvollziehbar.
2. Beratung zu Strategie und Alternativen
Jede IT-Infrastruktur ist anders. Deshalb entwickeln unsere Expertinnen und Experten eine maßgeschneiderte Migrationsstrategie für Ihr Unternehmen:
- Entscheidungshilfe: Upgrade vs. Hardwaretausch vs. ESU
- Empfehlungen für LTSC, Linux oder andere Alternativen
- Planung für hybride oder cloudbasierte Zukunftsszenarien
Sie profitieren von neutraler Beratung, fundierter Erfahrung und praxisnahen Empfehlungen.
3. Reibungsloser Rollout – technisch und organisatorisch
Unsere IT-Spezialisten übernehmen auf Wunsch die komplette Projektumsetzung:
- Einrichtung und Konfiguration von Windows 11 und Microsoft 365
- Migration von Daten, Benutzerprofilen und Anwendungen
- Integration in bestehende Sicherheits- und Netzwerkinfrastrukturen
- Testing, Dokumentation und Qualitätssicherung
Wir koordinieren alle Beteiligten und stellen sicher, dass Ihr Geschäftsbetrieb durch die Migration nicht beeinträchtigtwird.
4. Schulungen und Nutzerakzeptanz
GECKO bietet auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Trainingskonzepte:
- Einführungsschulungen für Mitarbeitende
- Technische Einweisungen für Administratoren
- Onboarding-Materialien, Tutorials und Helpdesk-Begleitung
Ziel ist eine hohe Nutzerzufriedenheit und minimale Einarbeitungszeit – auch bei komplexen Neuerungen.
5. Managed Services für nachhaltige IT-Sicherheit
Nach der Migration betreuen wir Ihre IT-Infrastruktur auch langfristig – im Rahmen unserer Managed IT-Services:
- Monitoring und Patch-Management
- Sicherheitslösungen für Endgeräte und Netzwerke
- Backup, Recovery und Datenschutzlösungen
Damit sind Sie auch in Zukunft bestens abgesichert – unabhängig vom Lifecycle einzelner Softwareprodukte.
6. Vorteile mit GECKO auf einen Blick
| GECKO-Leistung | Ihr Vorteil |
|---|---|
| Strategische Beratung | Zukunftssichere Entscheidungen |
| Technische Umsetzung | Minimale Ausfallzeiten |
| Schulungsmaßnahmen | Schnelle Nutzerakzeptanz |
| Managed Services | Langfristige Entlastung der IT-Abteilung |
| Datenschutzkonforme Umsetzung | Rechtliche Sicherheit nach DSGVO |
Fazit: Jetzt strategisch planen und Risiken vermeiden
Das Support-Ende von Windows 10 und Office 2019 am 14. Oktober 2025 markiert einen entscheidenden Wendepunkt für die IT vieler Unternehmen. Wer nicht rechtzeitig reagiert, setzt sich vermeidbaren Risiken aus – von Sicherheitslücken über DSGVO-Verstöße bis hin zu Betriebsunterbrechungen durch inkompatible Software.
Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick:
- Sicherheitsrisiko: Ohne Sicherheitsupdates steigt die Angriffsfläche erheblich – insbesondere durch Ransomware, Zero-Day-Exploits und Social Engineering.
- Compliance-Risiken: Der Betrieb veralteter Systeme kann zu Datenschutzverletzungen und Haftungsfragen führen.
- Technologische Sackgasse: Ohne Upgrades drohen Einschränkungen bei der Nutzung moderner Anwendungen, insbesondere im Microsoft-365-Umfeld.
- Kostenfallen vermeiden: Die verzögerte Umstellung kann teurer werden als eine frühzeitige Migration – etwa durch ESU-Kosten, Sicherheitsvorfälle oder ungeplante Hardwarekäufe.
Jetzt aktiv werden – mit GECKO als Digitalisierungspartner
Die Zeit bis Oktober 2025 sollte genutzt werden, um die eigene IT-Landschaft zukunftssicher aufzustellen. Mit GECKO gewinnen Sie:
- Eine fundierte Bestandsaufnahme und individuelle Migrationsstrategie
- Technische Kompetenz für sichere Umstellungen auf Windows 11 und Microsoft 365
- Entlastung durch Managed Services und IT-Betrieb auf höchstem Niveau
Ob kleiner Betrieb oder große Organisation – GECKO unterstützt Sie dabei, Risiken zu vermeiden und Chancen zu nutzen. Denn moderne IT ist kein Kostenfaktor, sondern ein Wettbewerbsvorteil.